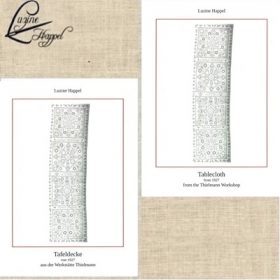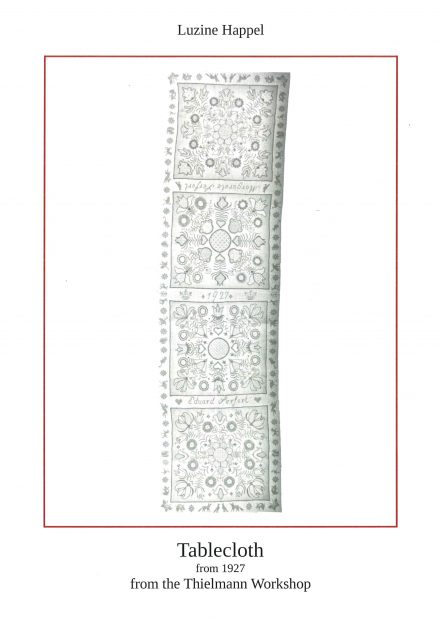A popular way to create an area between two outlines are interlaced herringbone stitches. They are called “Schlängchen” (curved lines) in Schwalm, just like the interlaced straight stitches “Kerrercher”. The method can be found in my publication Schwalm Curved Lines, Narrow Borders, and Ornamental Stitches on pages 44 and 45.
Interlaced herringbone stitches can also occasionally be found in historical Schwalm whitework, as here on a baby sling from 1866, where they were embroidered to decorate the double outline of a basket.
Today they are mostly embroidered around heart motifs.
These are almost always additionally surrounded with half-eyelet scallops,
sometimes also with knife points.
This type of decoration can also be used effectively on double outline of circles.
I haven’t been able to find an example of a tulip yet.
See also:
Double Outlines (1) – Remaining Free Areas
Double Outlines (2) – Interlaced Straight Stitches
Traditional Schwalm Whitework
Transition from Early to Later Schwalm Whitework (1)
Schwalm Whitework – Sunflowers
Schwalm Parade Cushion Border (A)
Traditional Schwalm Bodice (D) Embroidery